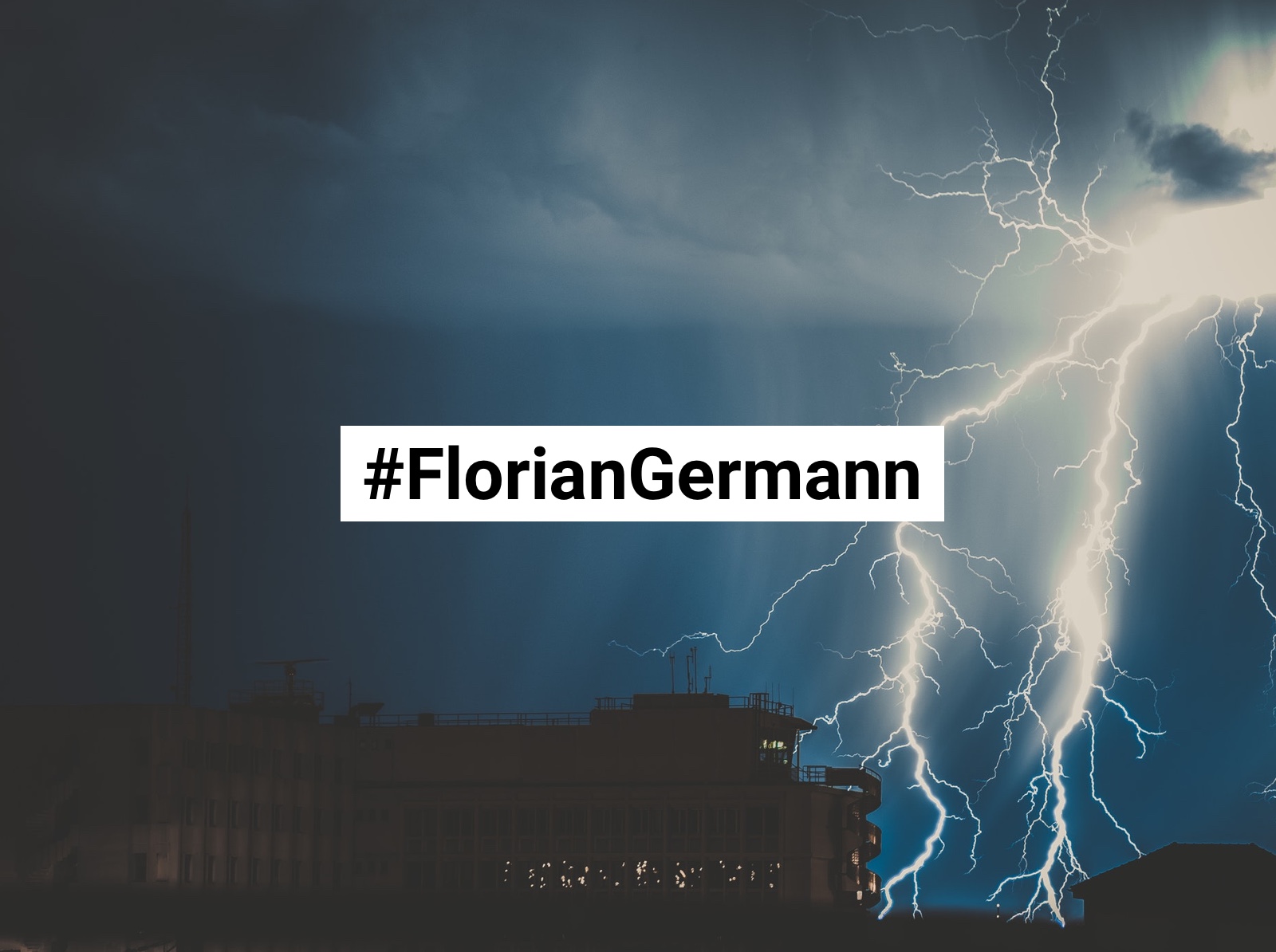Die geregelte Armenfürsorge in Zürich geht auf Huldrych Zwingli zurück. In Zwinglis Almosenordnung heisst es: «Als erste Massnahme, um die armen Leute von der Gasse wegzubringen, ist als Anfang vorgesehen, dass jeden Tag im Dominikanerkloster ... Mus und Brot verteilt [werden soll].» Das Café Yucca ist ein Schauplatz dieses Denkens im heutigen Zürich.
Es ist ein unscheinbarer Ort in einer unscheinbaren Gasse im Zürcher Niederdorf, zwischen Take Aways, Kleiderläden und noblen Cafés. Ein dezentes Leuchtschild weist auf den Namen: Café Yucca, Zürcher Stadtmission. Man könnte ungeachtet dessen, was dieser Ort für eine Geschichte, was er für eine Bedeutung hat für Menschen mit brüchigen Biografien und schwierigen Realitäten, daran vorbeischreiten, zum Seilergraben rauf, oder runter an die Zähringerstrasse. Man kann aber auch die Glastür aufstossen, am Mittag, am Abend, montags bis sonntags, sich von den Gastgebern mit einem Sali und von den Gästen eventuell mit einem Kopfnicken begrüssen lassen.
Das Café Yucca ist an die beliebte Wohnzimmer-Palme angelehnt, aber leitet sich auch von Juca ab. Jugendcafé hiess es in früheren Tagen. Gegründet als Reaktion auf die 68er, in der «Zeit der Halbstarken und Rocker», wie es auf der Website der Stadtmission Zürich heisst, entwickelte sich das Yucca zu einem Treffpunkt für sozial benachteiligte Menschen. Ein paar wenige Jugendliche, die damals das Juca aufsuchten, sind auch heute noch Gäste. Am Mittag ist die Suppe gratis, abends nach 21 Uhr ebenfalls, Konsumationspflicht herrscht keine.
Kurt Rentsch kennt die Geschichte des Yucca am besten. 53 Jahre alt, geboren im Oberaargau, gelernter Landschaftsgärtner, Absolvent eines theologischen Seminars in Deutschland und seit 25 Jahren im Team des Café Yucca. Der Mann mit Schnauz, leicht verwehtem Haar, feiner Brille und legerer Garderobe begrüsst zum Termin, er hat Zeit, er nimmt sich Zeit, «habe ich mir eingeschrieben» , wie auch für die Menschen, die ein und ausgehen im Café Yucca, jeden Tag. 63 waren es letztes Jahr im Durchschnitt täglich, an diesem Dienstagmittag im Mai sind es drei Männer, die da sitzen, über ihre Smartphones gebeugt, den Kopf in den Armen vergraben, mit Suppe an der Theke.
Wenn man Rentsch danach fragt, nimmt er sich Zeit. Also erzählt er, in einem von jahrelangem Wohnen in Winterthur und Arbeiten in Zürich schon ganz abgeschwächtem Berndeutsch, von Menschen, Individualismus und Glaube, seinem Krebs, Umweltschutz und Zwingli versus Luther, von schnittigen Karren und den Songtexten der Toten Hosen, von Putin und Personenfreizügigkeit, von den Anfängen des Café Yucca und seinem eigenen Anfang, 1993, vor bald 25 Jahren als Wirt, Koch, Seelsorger.
Es ist diese Kombination, die das Café Yucca zu einem besonderen Ort macht, es ist die Tatsache, dass Rentsch jeden der Menschen, der hier ein- und ausgeht als Gast bezeichnet und sich selber als Gastgeber. «Das ist unser Kerngeschäft. Das sind Gäste, keine Randständige, weil: Was heisst denn randständig? Am Anfang war ja ich randständig, ich kam aus dem Kanton Bern, vom Land, mitten hierher», sagt Rentsch, um dann Minuten später zu sagen: «Gegenüber Buenos Aires ist Zürich ja ein herziges Dorf.»
Es sind solche Sätze, die immer wieder fallen, die zeigen: Dieser Mann denkt in eigenen Kategorien, in unscharfen vielleicht, aber nicht in unverständlichen. Rentsch spricht von Ausländern, «die meinen, sie müssen das Geschirr nicht aufräumen, weil dafür Frauen da sind» und schreitet ein, wenn alteingesessene Stammgäste rassistische Kommentare fallen lassen. Früher seien es die Drögeler gewesen, heute die Ausländer, die manche Stammgäste am liebsten weghaben würden. «Futterneid ist ein Riesenthema», sagt Rentsch. Natürlich sei es schwierig, natürlich gebe es Scherereien, «aber das ist überall so, wo unterschiedliche Menschen einander begegnen, wo gelebt wird. Das muss man halt aushalten». Wieder so ein Satz.
Die Hausordnung aber, die ist heilig, das A und O, wer sie nicht einhält, verwirkt sein Gastrecht: Respekt, keine Gewalt, Hund an die Leine, keine Musik aus elektronischen Geräten, Geschirr abräumen. Wobei eben, das Geschirr. «Das ist manchmal wirklich schwierig», sagt Rentsch. Dabei würde man denken, die Kategorie «schwierig» würde bei einem Menschen wie Rentsch für andere Dinge gelten als für nicht abgeräumtes Geschirr. Als der 53-Jährige 1993 im Yucca seinen Dienst antritt ist der Platzspitz gerade erst geschlossen worden. Die Szene hat sich verlagert, manche Dealer richten sich im Yucca ein. «Da lagen Pistolen und Messer auf den Tischen, das war gefährlich», sagt Rentsch. «Belagerungszustand.» Die Drogenszene am Letten ist das Thema im Yucca, der Letten ist das Thema, wenn Rentsch zu Hause den Fernseher anschaltet. Die Stammgäste bleiben weg, das Café schliesst in Eigenregie die Tore, um sie einen Monat später wieder zu öffnen.
2005 erkrankt Rentsch an Krebs, rätschbätsch habe es ihn erwischt, doch er kommt davon und fragt sich: Was sag ich jetzt? Warum kommst du davon und die anderen verräblets? «Mit einem geheilten Krebs kannst du nicht bluffen», sagt Rentsch im Café, «dann wäre Gott ja ungerecht». Glaube, Spiritualität, auch das begleitet Rentsch bei seiner Arbeit. Nach Hause nimmt er nie etwas, für die schwierigen Dinge gebe es im Hinterraum des Cafés die Kapelle mit dem Kreuz. «Dann sage ich: Das musst du jetzt aushalten». Doch missionieren liegt Rentsch fern, «hätte man mir gesagt; das ist eine Stelle mit Missionsauftrag, hätte ich mich nicht beworben», sagt er.
Die schwierigen Dinge sind zum Beispiel Geschichten wie die des jungen Mannes, der vor wenigen Jahren nach einem Gespräch mit Rentsch aus dessen Büro tritt und Rentsch weiss; den wird er nicht mehr sehen. Ein paar Tage später bestätigt ihm die Mutter am Telefon, dass er sich das Leben genommen hat. «Item», sagt Rentsch an diesem Dienstagmittag an einem der Holztische beim Fenster, das Café leite keine Schritte ein, die die Person nicht wolle, das Angebot sei niederschwellig, ohne Verpflichtungen auf beiden Seiten, das Ziel in erster Linie, dem Gast ein Gegenüber zu bieten. Wirklich aus der Ruhe gebracht wird Rentsch höchstens, wenn etwas im Betrieb nicht läuft. Die Finanzierung wird schwieriger, die Kirchen verzeichnen immer weniger Mitglieder und immer weniger Spender. «Wenn ich dann sehe, wie viel Reichtum hier ist, und wenn ich dann sehe, wie dieser in Form von schnittigen Karren durch’s Niederdorf rasselt, dann könnte ich fast zum Verbrecher werden», sagt Rentsch und lacht, ohne Bitterkeit.
Doch noch überlebt das Yucca, noch trägt es die Gäste mit, noch bewegt es sich weiter und bietet den sich immer verändernden und den bleibenden Gästegruppen ein Wohnzimmer. Und Rentsch? «Gäbe es diesen Ort nicht, man müsste ihn erfinden», sagt der 53-Jährige gleich zwei Mal, er könne sich auch gar nicht vorstellen, etwas anderes zu machen, auch wenn man nie wisse, wie lange die Kräfte halten. «Wie sagen die Toten Hosen? Nichts bleibt für die Ewigkeit.»